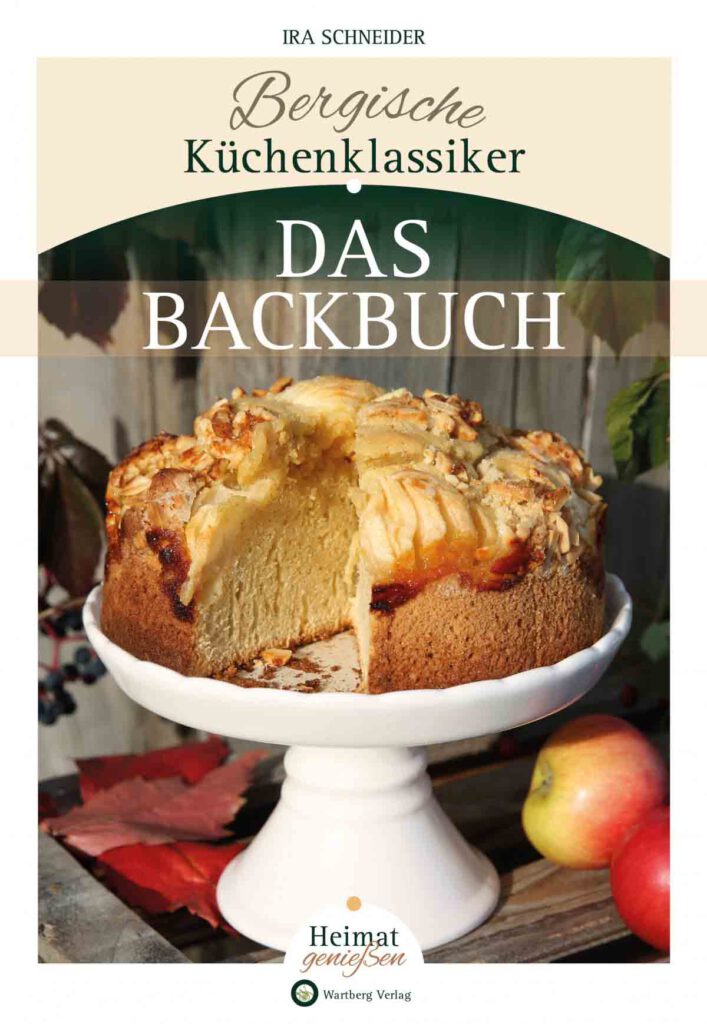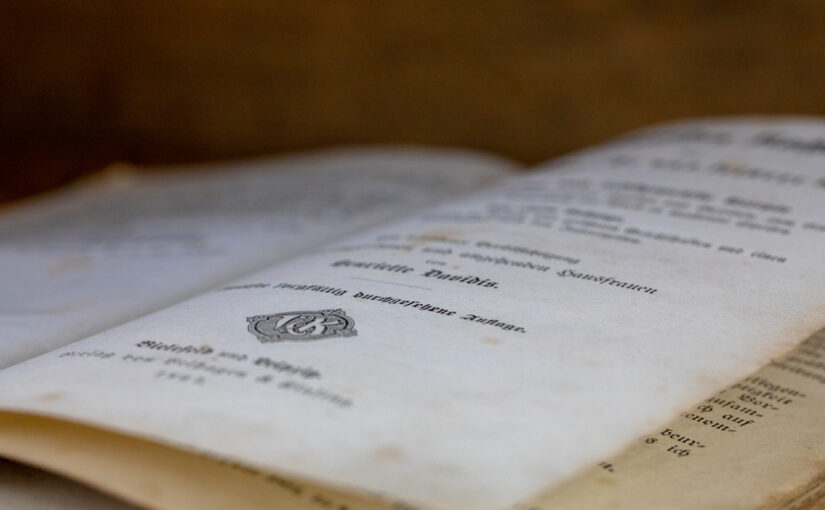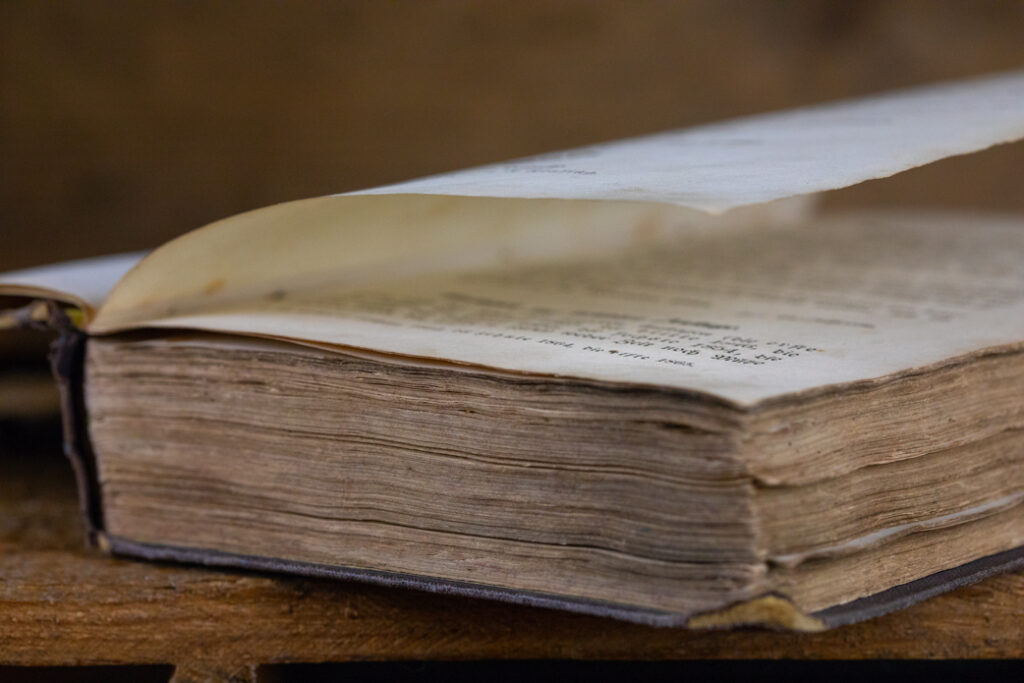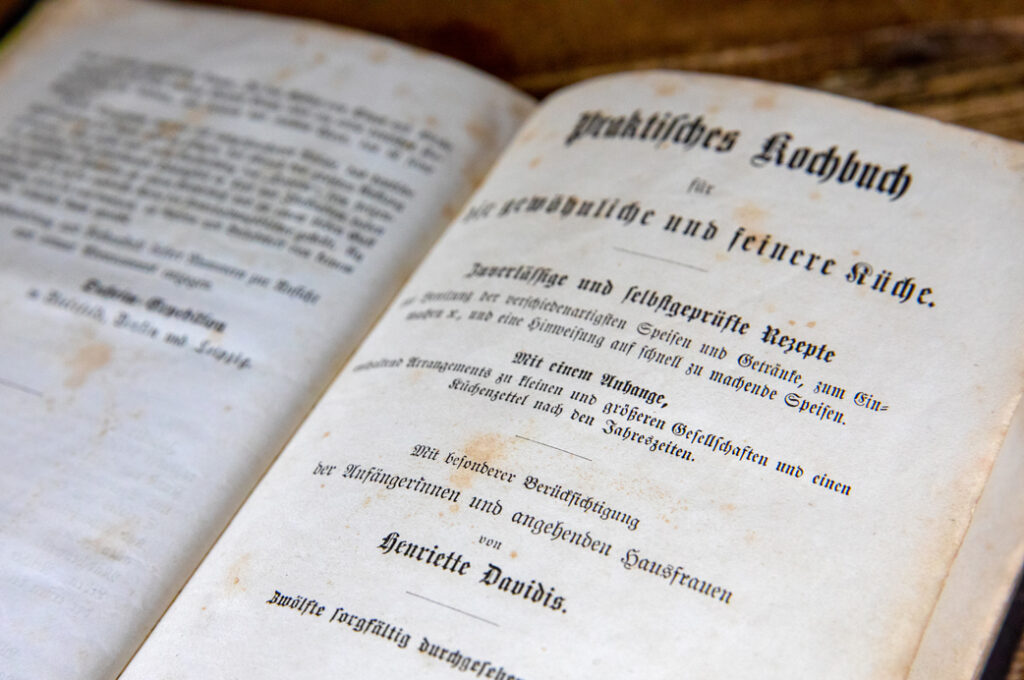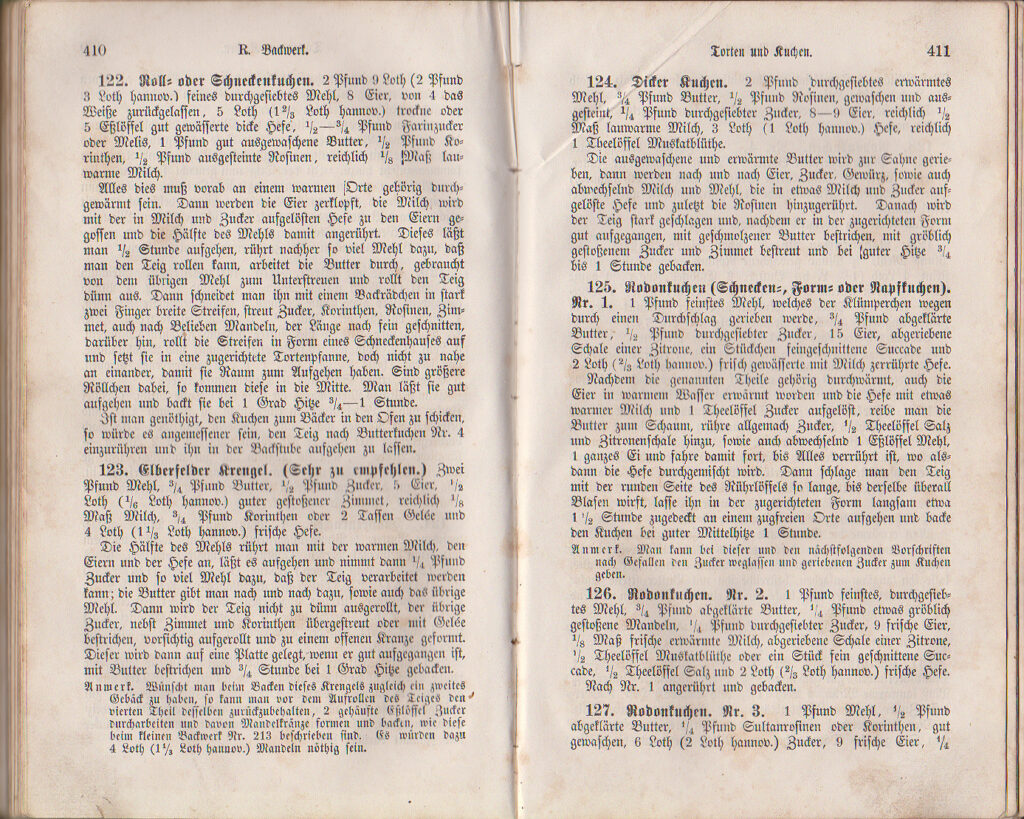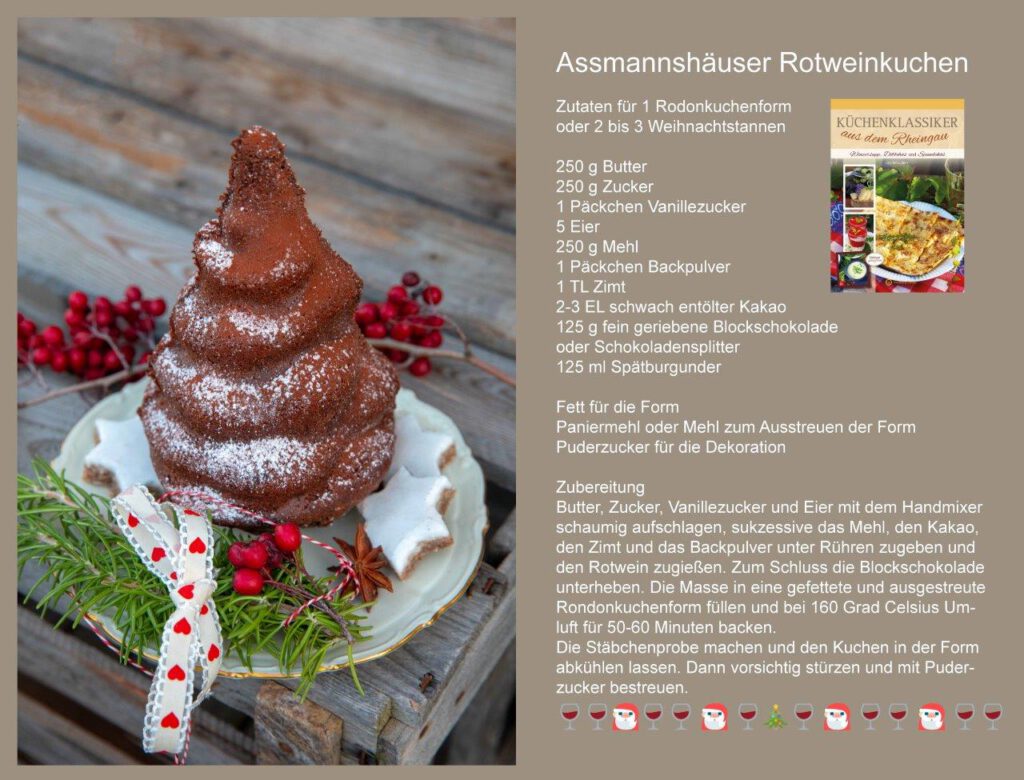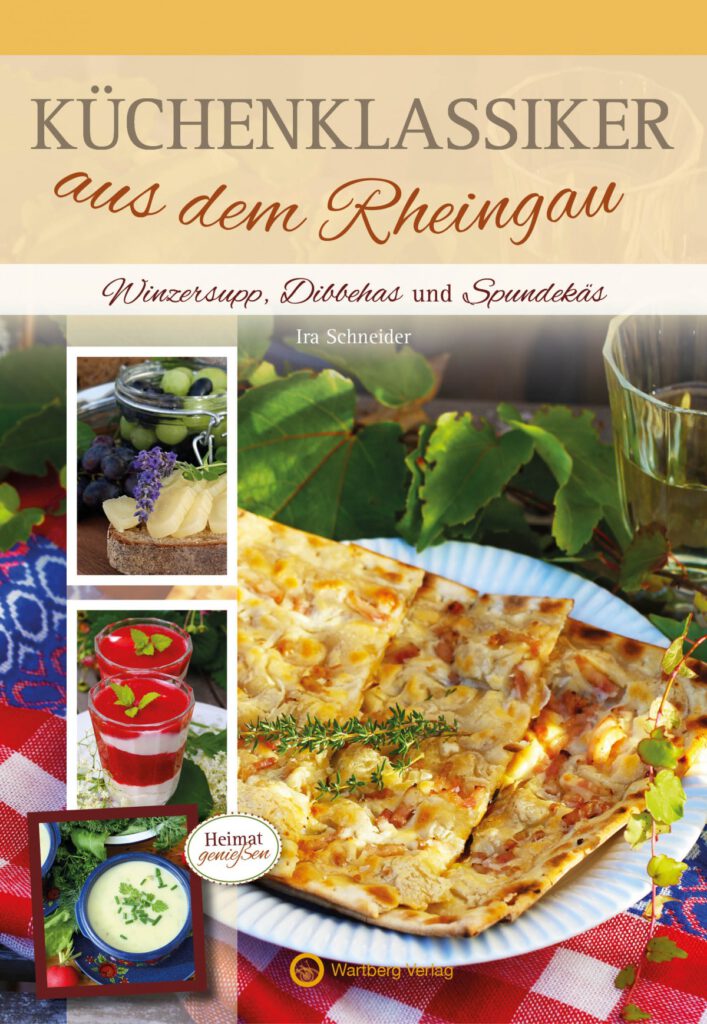Zu Besuch bei einer Neu-Imkerin
Selbstimkern liegt im Trend. Für viele Anfänger zählt nicht nur der Honig-Ertrag, sondern vor allem die Leidenschaft für Biene und Kulturlandschaft. Zu Besuch bei der Neu-Imkerin Claudia aus Wachtberg bei Bonn habe ich erfahren – wie man in das Hobby einsteigen kann. Darüber hinaus gab’s auch noch fachkundige Infos zu dem vielseitigen Naturprodukt.
Wie alles begann
„Alles fing an mit dem Roman ‚Die Geschichte der Bienen‘. Dann kam ein Sachbuch nach dem anderen und mein Interesse an diesen kleinen faszinierenden Tieren wuchs stetig. Schließlich ermutigte mich mein Partner zu diesem neuen Hobby. Eigentlich war es im Spaß gemeint, aber dann ich doch mehr daraus geworden“, so Claudia, die als Betriebswirtin in einer Software-Firma arbeitet. Interessiert hat sie im Internet nach Informationen und Seminaren gestöbert. Denn es benötigt schon etwas Wissen in Theorie und Praxis, bevor man startet. Über den Imkerverband hat die Neu-Imkerin dann Einsteigerkurse, die es sogar online gibt, absolviert.

Fazination Biene
Die Honigbiene ist in der Tat ein faszinierendes Insekt, denn sie besucht etwa zehn bis 15 Millionen Blüten, um ein Kilogramm Honig zu produzieren. Durch ihre Bestäubungstätigkeit leisten die kleinen Lebewesen einen ungeheuerlich großen Beitrag zum Bestand der weltweiten Artenvielfalt. Ursprünglich stammt sie aus Südostasien und zählt neben Rind und Schwein mit zu den ältesten Nutztieren der Menschheit, denn schon bei den alten Ägyptern findet man Hinweise auf Bienenhaltung. Weltweit gibt es über 20.000 Bienenarten, von denen allerdings nur einige Hundert arbeitsteilige Staaten von bis zu 60.000 Tieren pro Stock bilden. Für die Imkerei ist hierzulande die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) von Bedeutung, die man wiederum in über 20 Unterarten oder Rassen unterteilt. „Besonders bemerkenswert finde ich, dass es in einem Stock von der Putzbiene über die Amme, die Honigmacherin, die Baubiene, die Wächterin am Eingang bis hin zur Sammelbiene verschiedene Stationen mit Aufgaben gibt, die eine Biene während ihres kurzen Lebens von nur einigen Wochen durchläuft“, so Claudia.

Auch dass eine Biene schon während des Sammelns von Nektar oder Honigtau diesen mit Enzymen anreichert und bereits hier das Honigmachen beginnt, fasziniert Claudia an den kleinen Insekten. „Im Stock übergibt die Sammelbiene ihr Sammelgut an die Stockbiene, welche es kaut und in die Wabenzellen einlagert. Die Bienen trocknen, wenn man so will, den eingelagerten Nektar, der durch Enzyme zu Honig reift. Sobald er trocken genug ist, wird er durch einen dünnen Wachsdeckel versiegelt“, erläutert die Imkerin.

Individueller Geschmack
Der Geschmack oder Charakter eines jeden Honigs ist einzigartig und hat mit dem Standort des Bienenstocks zu tun. Eine Honigbiene kann vom Stock bis zur Blüte in einem Radius von bis zu 5 Kilometern ausschwärmen und das macht eine einzelne Biene bis zu 16 Mal pro Tag. „Hier in Adendorf haben wir viele Obstplantagen mit Äpfeln und Erdbeeren. Darüber hinaus gibt es Felder mit Raps, Weiden mit Löwenzahn und Wildblumen und Gärten mit verschiedenen Blühpflanzen. Mein erster Honig wird dementsprechend ein Blütenhonig sein. Aber bis dahin müssen sich die Bienen erst einmal gut eingewöhnen, viele Nachkommen produzieren und den ersten Winter überstehen“, so die Imkerin, die auch selbst eine Bienenweide mit Wildblumen direkt vor den Bienenstock ausgesät hat – um ihre Tiere beobachten zu können.

Start mit zwei Bienenstöcken
„Nach meinen ersten Kursen habe ich Ausschau gehalten nach geeignetem Equipment. Für den Start wollte ich erst einmal klein anfangen mit zwei Stöcken. Die Bienenkästen habe ich von einem Imker übernommen, der aus Altersgründen aufgehört hat“, so Claudia. Dass man einen Imkeranzug und eine Pfeife benötigt, denn so wird der Imker immer noch auf Bildern dargestellt, ist überholt. Der moderne Imker oder die moderne Imkerin braucht „nur noch“ einen Imkerhut mit Schleier zum Schutz des Gesichts und einen sogenannten Smoker. Das ist ein kleines Gerät, ähnlich einer Konservendose mit einem Blasebalg und einem Mini-Schlot, aus dem dann der Rauch strömt, während im Inneren ein wenig Pappschachtel und trockenes Gras brennen. „Wenn ich die Kästen öffne, um die Waben zu kontrollieren, bringe ich den Rauch direkt auf die Waben aus. Das ist das Zeichen für die Bienen – dass der Wald brennt. Bevor sie flüchten, nehmen sie dann noch einmal viel Honig zu sich und bleiben auf der Wabe. Während sie beschäftigt sind, kann ich in Ruhe an den Rahmen arbeiten“, so Claudia.

Wabenpflege
Mit einem Spachtel, den man Stockmeißel nennt, schabt die Imkerin nach dem Öffnen des Bienenstocks den überschüssigen Wachs von den Rahmen, damit sich diese lösen und herausnehmen lassen. „In jedem Bienenstock, der bei uns Imkern übrigens Beute heißt, befinden sich Holzrähmchen, mit denen man den Bienen eine Art Bauvorgabe macht. Würde man das nicht tun, würden sie wilde Gebilde bauen und man hätte später dadurch Schwierigkeiten beim Schleudern des Honigs“, so Claudia – die sich dann sukzessive jeden einzelnen Rahmen und die darin gebauten Waben sowie Arbeiterinnen und Brut anschaut. Sie zählt dann die Bienen auf jedem Rahmen nach einem bestimmten Schema und kann anhand des Besatzes sehen, wie gut es ihrem Volk geht.

Besonders die Kinderstube mit Eiern und Laven schaut sie sich genau an. „Anhand des Entwicklungsstadiums der Larven kann ich sehen, wie legefreudig die Königin ist und wie gut die Ammenbienen die Brut versorgen“, so Claudia – die in ihrer Freizeit zum sozialen Leben der fleißigen Insekten diverse Bücher und Filme förmlich verschlingt.

„Wenn das Volk im Stock wächst und gedeiht, kann man sukzessive mehr Rähmchen in die Beuten einhängen. Die Bienen werden so weiter zum Bauen und zur Honigproduktion animiert“, erläutert die 32-jährige, die mit ihren beiden Stöcken ein bis zwei Stunden Arbeit die Woche für das Hobby aufbringt. Aber das ist erst der Anfang. Wenn es mal mehr Stöcke werden und die Honigproduktion in vollem Gange ist, dann nimmt sie für ihr Bienen-Hobby phasenweise auch gerne noch mehr Stunden in Kauf.

Honig – gelbes Gold
Im ersten Jahr wird die Neu-Imkerin allerdings keinen Honig ernten können – denn die beiden Völker sind noch zu klein und die Honigmengen zu gering. „Um zu wachsen, benötigt das Volk den Honig im Moment für sich selbst. Im nächsten Jahr rechne ich allerdings mit einem ersten Ertrag. Man sagt dass, ein Volk pro Jahr bis zu 30 Kilogramm Honig produziert“, so Claudia. Damit sich sogenannte Klein-Imker nicht selbst eine teure Schleudermaschine anschaffen zu müssen, bietet der Imkerverein, in dem Claudia Mitglied ist, sogenannte Schleuderpartys an. Das sind Treffen, bei denen die Imker zusammenkommen, um gemeinsam den Honig aus ihren Waben zu schleudern, den Honig zu reinigen und professionell in Honiggläser abzufüllen. Gemeinsam macht das natürlich auch mehr Spaß und der Austausch unter Kollegen ist auch wichtig und man unterhält sich über dies und das rund um die Biene und den Honig. Eines der brennenden Imker-Themen ist immer wieder die Varroa-Milbe.
Tücken des Imker-Seins
„Die Varroa-Milbe ist – wenn man so will – der größte Feind der Bienenvölker. Das Biest schmuggelt sich sozusagen undercover in den Bienenstock und vermehrt sich in der verdeckelten Brut. Dort saugt die Milbe bereits an den Bienenlarven und schwächt sie. Aber auch ältere Tiere können befallen werden“, so Claudia. Wichtig ist daher bei der regelmäßigen Kontrolle der Stöcke und Waben auf erste Anzeichen zu achten. Wenn man Milben findet, sollte man eine Varroa-Behandlung durchführen – um das Volk zu retten.
Insgesamt gilt: Nur wenn das Volk gesund und kräftig bleibt, wird es auch schwierige Zeiten wie schlechte Wetterperioden mit wenig Nahrungsangebot überstehen. „Sein Volk gut über den Winter zu bringen, ist eine weitere Herausforderung. Auch im Winter schaue ich, wie es dem Volk geht und überprüfe den Futtervorrat“, so die Imkerin.
Neues Jahr – neues Imkerglück
Sobald die Temperaturen im Frühjahr jedoch steigen, nimmt das imposante Zusammenspiel im Stock mit der Eiablage durch die Königin erneut an Fahrt auf. Und spätestens im April ist das neue Honigjahr in vollem Gange! Je nach Jahreszeit und Tracht gibt es ganz verschiedene Honige, die alle anders – von mild bis kräftig-würzig im Aroma und – je nach Zusammensetzung der Zuckerarten – von flüssig bis cremig in der Konsistenz – sind. Mit Tracht meint der Imker oder die Imkerin im Übrigen das gesamt Angebot an Nektar, Pollen und Honigtau, welches die Bienen sammeln und in ihrem Stock verarbeiten.
Wer nun auch Lust bekommen hat aufs Imkern, der kann sich hier über Seminare und weitere Schritte erkundigen:

Auch wer keine Bienen hält, aber einen Garten oder Balkon hat, kann die fleißigen Tiere und den Erhalt der heimischen Vielfalt unterstützen, indem er Blumen, Bäume und Pflanzen in sein Umfeld holt, die eine Nahrungsquelle für Bienen darstellen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat hierzu jüngst ein Lexikon Bienenfreundliche Pfanzen in Broschürenform herausgegeben. Auch eine Bienen-App fürs Handy ist im Play oder App Store verfügbar.
Ein Filmchen vom Besuch bei Claudia findet Ihr auch auf dem Youtube-Kanal von „Die Fotoküche“ unter diesem Link.
Leckeres mit Honig
Das Naturprodukt Honig ist nicht nur sehr vielseitig im Aroma, sondern auch vielfältig in der Küche einsetzbar. Ob im Salatdressing, in Grillmarinaden und Bratensoßen oder aber ganz klassisch als Süßungsmittel für Gebäck, Desserts und Getränke – mit Honig verleiht man seinen Kreationen ein einzigartiges Flair. Hier gibt es einige Rezept-Ideen.
Bienenstich – ein Rezept aus „Bergische Küchenklassiker – Das Backbuch“ (Wartberg Verlag)

Zutaten für 1 Springform à 26-28 cm
Für Boden und Deckel
400 g Mehl, 30 g Hefe, 125 ml Milch, 50 g Zucker, 50 g weiche Butter, 2 Eier Größe M, 1 Prise Salz, 1 Zitrone, davon der Abrieb
Für die Buttercreme
800 ml Milch, 2 Päckchen Puddingpulver Vanille- oder Sahnegeschmack, 100 g Zucker, 100 g weiche Butter
Für die Mandelmasse
100 g Mandelstifte, 100 g Butter, 100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 4 EL Milch, 2 EL Mehl, 2 EL Bienenhonig, wahlweise 100 g rotes Johnannisbeergelee
Zubereitung
Für Boden und Deckel zunächst einen Hefe-Vorteig bereiten. Dann die übrigen Zutaten zugeben und den Teig abermals gehen lassen, bis er sich nahezu verdoppelt hat.
Für die Buttercreme 600 ml Milch mit dem Zucker zum Kochen bringen. Das Puddingpulver mit der restlichen Milch verrühren und sobald die Milch kocht unter ständigem Rühren zugeben. Die Puddingmasse anziehen lassen und sofort von der Herdplatte nehmen. Etwas abkühlen lassen, bis die Masse nur noch lauwarm ist. Die Butter schaumig schlagen und löffelweise die Puddingmasse zugeben. Die Creme kaltstellen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen.
Für die Mandelmasse Zucker, Vanillezucker, Bienenhonig und Milch zum Kochen bringen. Butter, Mandeln und Mehl unter ständigem Rühren zugeben und kurz mitkochen, bis die Masse anzieht. Kurz abkühlen lassen. In der Zwischenzeit den Teig rund ausrollen und in eine gefettete Springform geben. Die Mandelmasse aufstreichen und den Kuchen bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze circa 30 Minuten backen, bis die Mandelmasse goldbraun ist.
Den Kuchen aus der Springform nehmen, auf einem Gitter auskühlen lassen und dann in der Mitte durchschneiden. Den unteren Teil nach Geschmack zunächst mit Johannisbeergelee bestreichen und dann die Buttercreme darübergeben. Den oberen Teil, den Mandeldeckel, in 12 Kuchen-Stücke schneiden und diese auf der glattgestrichenen Buttercreme wieder zusammensetzen. Den Kuchen bis zum Verzehr kühlstellen.
Linsensalat mit Ziegenkäse – ein Rezept aus „Niederrheinische Küchenklassiker“ (Wartberg Verlag)
Zutaten für 4 Personen
500 g braune Linsen, 1 Bund Suppengrün, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Zucker
Für die Vinaigrette
4 EL Himbeeressig, 6 EL Sonnenblumenöl, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer, frische Gartenkräuter
Zubereitung
Das Suppengemüse putzen und kleinschneiden. Die Knoblauchzehe auspressen. Beides in etwas Öl kurz anschwitzen und mit 700 ml leicht gesalzenem Wasser oder Brühe ablöschen. Die Linsen zugeben und bei geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis sie gar – aber noch bissfest sind. In der Zwischenzeit die Vinaigrette bereiten. Die Linsen abschütten und mit der Vinaigrette verrühren. Mit gehackten Gartenkräutern, Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipp
Mischen Sie feine Blattsalate der Saison, Tomaten oder Erdbeeren unter den Linsensalat und dekorieren ihn mit feinem Ziegenkäse nach Feta-Art. Wer es besonders herzhaft mag, kann die Vinaigrette noch mit einer gehackten Zwiebel verfeinern.